Faktencheck DVAG – Das Wichtigste in Kürze
Vertrieb statt unabhängiger Beratung
Die DVAG tritt als „Allfinanzberater“ auf, agiert jedoch als provisionsgetriebener Strukturvertrieb. Empfehlungen basieren oft nicht auf neutraler Marktanalyse, sondern auf Produkten der Hauptpartner – allen voran Generali, die zugleich Großaktionär ist.
Emotionen als Verkaufsstrategie
Die Beratung ist stark emotionalisiert – Begriffe wie „Sicherheit“ oder „Vertrauen“ stehen im Vordergrund, nicht immer Transparenz. Persönliche Nähe wird betont, obwohl dahinter ein klar kalkuliertes Vertriebssystem steht.
Hierarchisch organisiert mit internem Druck
Berater sind selbstständige Handelsvertreter ohne Grundgehalt. Wer aufsteigt, verdient an Untergebenen mit – ein System, das Kritiker als pyramidennah und leistungsfremd kritisieren. Viele Einsteiger scheitern früh.
Kritik an mangelnder Kostenklarheit
Stiftung Warentest und andere Medien bemängelten wiederholt, dass Kunden oft nicht wüssten, wie teuer DVAG-Produkte wirklich sind. Die Beratungen seien häufig intransparent – insbesondere bei Gebühren und Abschlusskosten.
Reputationspflege mit Risiken
Während die DVAG öffentlich auf Kundenumfragen und Auszeichnungen verweist, existieren zahlreiche kritische Stimmen – von Aussteigern, Verbraucherschützern und Journalisten. Auch juristische Auseinandersetzungen und manipulierte Bewertungen belasten das Image.
Was bietet die Deutsche Vermögensberatung – und was steckt wirklich dahinter?
Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) bezeichnet sich selbst als Allfinanz-Anbieter und bietet laut Eigenbeschreibung ein umfassendes Paket an Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. Dazu zählen Versicherungen aller Art, Investmentfonds, Baufinanzierungen sowie klassische Bankprodukte wie Konten oder Kredite.
Ziel ist es, Kunden eine „ganzheitliche Finanzplanung aus einer Hand“ zu bieten – ein Versprechen, das auf den ersten Blick nach Effizienz und Sicherheit klingt.
Tatsächlich arbeitet die DVAG mit einer Vielzahl großer Partnerunternehmen zusammen, darunter Generali, DWS, Allianz Global Investors, die Deutsche Bank und Commerzbank. Doch trotz dieser vermeintlichen Vielfalt bleibt für Kunden oft verborgen, dass viele Produkte ausschließlich im DVAG-Vertrieb erhältlich und vorab gebündelt sind.
So werden etwa kombinierte Policen unter dem Label „Vermögensaufbau & Sicherheitsplan“ verkauft – ein Produkt, das Rentenvorsorge mit Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenschutz verknüpft. Solche Pakete gelten im Vertrieb als „maßgeschneidert“, sind in der Praxis jedoch stark standardisiert.
Emotion statt Transparenz?
Ein zentrales Verkaufsinstrument ist die emotionale Aufladung komplexer Finanzthemen. Die Berater – firmeneigen als „Finanzcoaches vor Ort“ tituliert – inszenieren sich als lebensbegleitende Vertrauenspersonen. Begriffe wie „Sicherheit“, „Nähe“, „Freiheit“ dominieren das Marketing.
Der Slogan „Menschen brauchen Menschen“ soll Nähe suggerieren, wo letztlich ein Geschäftsmodell dahintersteht. Intern wird die DVAG gar als „Familie, Heimat und Liebe“ verklärt – eine Rhetorik, die weniger nach neutraler Finanzberatung als nach Bindungsideologie klingt.
Kunden wird dabei häufig ein Gefühl vermittelt: Wer sich der DVAG anvertraut, muss sich um seine finanzielle Zukunft keine Sorgen mehr machen. Mit Aussagen wie „finanzielles Potenzial entfesseln“ wird suggeriert, dass der Weg zum Wohlstand lediglich einer guten Beratung bedarf – ein Narrativ, das Vertrauen schaffen, aber zugleich kritisches Denken unterbinden kann.
Vertrieb im Freundeskreis – ein ethisches Dilemma?
Auffällig ist auch der aggressive Rekrutierungsansatz: Neue Berater – oft Quereinsteiger – sollen gezielt ihr soziales Umfeld ansprechen. Die sogenannte „Warmmarkt-Strategie“ basiert auf der Idee, dass finanzielle Gespräche unter Freunden leichter geführt werden können.
Dabei entsteht eine problematische Vermischung von Privatleben und Geschäftsinteressen. Die Folge: Beratung findet in vertrauter Atmosphäre statt, ohne dass Kund:innen immer bewusst ist, dass sie Teil einer klar strukturierten Vertriebsmethode sind.
Hinzu kommt, dass Verkaufsargumente häufig auf emotionalen Triggern beruhen:
Angst vor Altersarmut, Verantwortung für die Familie oder der Wunsch nach Unabhängigkeit. Diese tief verankerten Gefühle werden genutzt, um Finanzprodukte als persönliche Lebenslösungen zu verkaufen – auch wenn nicht immer eindeutig ist, ob das Produkt tatsächlich zum Bedarf passt oder lediglich zum Provisionsziel des Beraters.
Kritik von Verbraucherschützern
Immer wieder geraten die Methoden der DVAG ins Visier von Verbraucherschützern.
Der Vorwurf: Viele Angebote seien nicht wirklich bedarfsorientiert, sondern auf den Abschluss provisionsstarker Kombi-Produkte ausgerichtet. Die Beratung sei daher nicht unabhängig, sondern interessengesteuert – trotz aller gegenteiliger Beteuerungen.
Die DVAG verkauft nicht nur Finanzprodukte, sondern ein ganzes Lebensgefühl – verpackt in emotionale Botschaften und persönliche Bindungen. Für Kund:innen kann das verlockend wirken. Doch wer hinter die Kulissen blickt, erkennt: Zwischen Marketingversprechen und tatsächlicher Beratungsrealität klafft oft eine Lücke, die kritische Fragen aufwirft.
Was bietet die DVAG – und wer zieht im Hintergrund die Fäden?
Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) präsentiert sich als familiengeführter Allfinanzkonzern, der Kund:innen mit einem „Rundum-Sorglos-Paket“ aus Versicherungen, Investmentprodukten, Baufinanzierungen und Bankdienstleistungen versorgt.
Doch hinter dem wohlklingenden Anspruch der „ganzheitlichen Finanzberatung“ verbirgt sich ein Vertriebsapparat, der stark auf Standardprodukte, enge Kooperationsmodelle und emotionale Bindung setzt – und damit vor allem eines im Blick hat: Umsatz.
Ein Familienimperium mit Konzernverbindung
Gegründet 1975 vom Juristen Dr. Reinfried Pohl, wird die DVAG heute von seinem Sohn Andreas Pohl geführt – nicht nur als Vorstandsvorsitzender, sondern auch als Hauptgesellschafter der Holdinggesellschaft. Über die Holding kontrolliert die Familie rund 60 % der Anteile und damit die Stimmenmehrheit.
Die restlichen knapp 40 % liegen bei keinem Geringeren als der Generali Deutschland Holding AG, dem deutschen Arm des italienischen Versicherungskonzerns. Diese enge Verflechtung ist kein Zufall: Seit Jahren betreibt die DVAG exklusiv den Generali-Außendienst in Deutschland – ein Modell, bei dem Familieninteressen und Konzernstrategie Hand in Hand gehen.
Diese Doppelstruktur – Familienmacht trifft Konzernkapital – spiegelt sich auch in den Gremien wider. Im Aufsichtsrat dominieren Vertreter der Generali-Gruppe, darunter Finanzvorstand Giulio Terzariol und Chefjustiziar Antonio Cangeri. Die Familie Pohl hingegen hält über den Vorstand operativ die Zügel in der Hand.
Kritiker sehen hier ein symbiotisches Machtmodell, das demokratischer Kontrolle weitgehend entzogen ist.
Netzwerke, Politiknähe – und Millionenspenden
Besonders auffällig ist die gezielte Nähe zur Politik. Die DVAG unterhält einen Beirat, in dem sich zahlreiche ehemalige Spitzenpolitiker tummeln – von Altkanzler Helmut Kohl (†) über Ex-Minister Theo Waigel bis hin zu bekannten Namen wie Petra Roth, Brigitte Zypries und Frank Bsirske. Diese personelle Vernetzung wirkt nicht wie zufällig gewachsen, sondern wie bewusst gepflegt – ein politisches Schutzschild für ein milliardenschweres Unternehmen.
Tatsächlich zeigt eine Auswertung von Lobbycontrol, dass die DVAG zwischen 2000 und 2020 über 7,9 Millionen Euro an Parteien spendete – mit einem Schwerpunkt auf CDU und FDP.
Es drängt sich die Frage auf, wie unabhängig politische Entscheidungen bleiben, wenn ein Finanzvertrieb in dieser Größenordnung finanziellen Einfluss geltend macht.
Die ökonomische Realität: Vertrieb mit System
Wirtschaftlich läuft es für die DVAG glänzend. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz und einen Gewinn von knapp 353 Millionen Euro – eine beachtliche Marge, die vor allem dem provisionsgetriebenen Vertriebssystem zu verdanken ist.
Auch wenn sich das Unternehmen gern als „Beratungshaus“ darstellt, basiert das Geschäftsmodell im Kern auf dem klassischen Strukturvertrieb: Tausende Berater – viele davon Quereinsteiger – vertreiben standardisierte Produktbündel im Namen großer Partner wie Generali, Deutsche Bank oder DWS.
Die Hauptprofiteure sind klar: die Familie Pohl, die ihre Anteile über die Holdinggesellschaft verwaltet, und Generali, das als Minderheitseigner mitverdient. Andreas Pohl selbst zählt laut Rankings zu den vermögendsten Unternehmern Deutschlands – seine Milliarden entstehen nicht durch produktive Innovation, sondern durch Vertriebsleistung und strategische Beteiligung.
Kritik, Skandale – und rechtlicher Gegenwind
In der Öffentlichkeit gibt sich die DVAG betont solide – doch ganz ohne Reibung läuft es nicht. Bereits in den 1990er Jahren machte ein Whistleblower, der Ex-Berater Wolfgang Dahm, mit einem Enthüllungsbuch auf Missstände im Vertrieb aufmerksam. Der Versuch der DVAG, gegen das Buch juristisch vorzugehen, scheiterte – die Meinungsfreiheit wog schwerer.
Auch später gab es Streitigkeiten, etwa mit dem umstrittenen Ex-Controller Stefan Schabirosky, der behauptete, im Auftrag der DVAG gegen Konkurrenten wie AWD agiert zu haben. Die DVAG wies die Vorwürfe zurück – die Gerichte gaben ihr Recht. Doch die Episode zeigt, wie aggressiv der Wettbewerb unter Finanzvertrieben geführt wurde – und bis heute geführt wird.
Ein mächtiger Player mit Schattenseiten
Trotz aller Kritik: Die DVAG wächst weiter, übernimmt andere Vertriebe und baut ihre Marktposition aus. Mehr als 18.500 Berater sind im DACH-Raum aktiv, flankiert von einem eng vernetzten Führungskreis und einem mächtigen Aktionär aus der Versicherungswelt. Das Unternehmen nutzt geschickt Emotion, Nähe und Vertrauen, um Produkte zu verkaufen – nicht immer zur Freude von Verbraucherschützern, die mangelnde Transparenz und Interessenkonflikte anprangern.
Fazit: Hinter der öffentlichkeitswirksamen Fassade einer „Familienberatung auf Augenhöhe“ steht ein durchstrukturierter Milliardenkonzern, der wirtschaftliche Interessen, politische Nähe und emotionalisierte Kundenbindung geschickt miteinander verknüpft. Für Kund:innen mag das wie persönliche Betreuung wirken – für Kritiker bleibt die DVAG ein Paradebeispiel dafür, wie Finanzvertrieb und Machtpolitik ineinandergreifen können.
Vertriebsstruktur der DVAG – ein System mit doppeltem Boden
Hinter dem freundlichen Auftreten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) steckt ein durchorganisiertes Vertriebsmodell, das in vielerlei Hinsicht an ein klassisches Multi-Level-Marketing-System erinnert – mit all seinen Chancen, Risiken und Widersprüchen.
Die Berater sind dabei keine Angestellten, sondern arbeiten als selbstständige Handelsvertreter auf Provisionsbasis. Fixgehälter, Kündigungsschutz oder soziale Absicherung? Fehlanzeige. Wer bei der DVAG Erfolg haben will, muss verkaufen – und zwar viel.
Vertrieb auf mehreren Ebenen – mit Druck von oben
Das Karrieremodell der DVAG folgt einer klaren Hierarchie: Neue Berater steigen als „Vermögensberater-Anwärter“ ein und arbeiten sich über Rangstufen wie „Bezirksleiter“ oder „Direktionsleiter“ nach oben. Das Ziel: Möglichst viele Verträge vermitteln – und möglichst viele neue Berater rekrutieren, an deren Provisionen man anteilig mitverdient.
Dieses Staffelprovisionssystem sorgt dafür, dass Führungskräfte an den Umsätzen ihrer „Downline“ beteiligt sind. Je mehr Leute unter einem arbeiten, desto lukrativer wird es – zumindest für die Spitze. Kritiker sprechen daher von einer strukturellen Nähe zum Pyramidenprinzip, auch wenn die DVAG diese Bezeichnung strikt zurückweist.
Das Problem: Für Neueinsteiger bleibt oft nur ein Bruchteil der Provision. Während ein Direktionsleiter mitunter über 400.000 Euro im Jahr verdienen, sehen viele Juniorberater kaum vierstellige Monatsumsätze – geschweige denn Gewinn. Die betriebswirtschaftlichen Risiken tragen sie allein, inklusive Stornohaftung: Kündigt ein Kunde vor Ablauf seiner Police, muss der Berater Teile seiner Provision zurückzahlen – bis zu fünf Jahre rückwirkend.
Zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit
Offiziell betont die DVAG die „unternehmerische Freiheit“ ihrer Vermittler. Die Realität sieht oft anders aus: Durch exklusive Produktvorgaben, hohe Umsatzerwartungen und vertragliche Bindungen (z.B. zweijährige Laufzeiten, Wettbewerbsverbote) entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis, das einem klassischen Angestelltenverhältnis in mancher Hinsicht ähnlicher ist, als es scheint – nur eben ohne die Rechte, die ein solches mit sich bringt.
Motivation durch Eventkultur und Gruppendruck
Damit das System funktioniert, investiert die DVAG massiv in Schulungen, Incentives und Motivation. Die firmeneigene Akademie bietet Zertifikate bis hin zum IHK-Abschluss – finanziert aus dem System heraus. Karriere-Seminare in Luxus-Atmosphäre, internationale Reisen, Auszeichnungen auf Bühnen mit tausenden Zuschauern: Die Außendarstellung gleicht einem Hochglanz-Event mit Kultcharakter.
Doch hinter der Glitzerfassade herrscht ein rigider Leistungsdruck. Wer nicht performt, wird schnell aussortiert oder subtil demotiviert.
Aussteiger berichten von regelrechten Schuldzuweisungen: Nicht das System sei das Problem – sondern der Einzelne, der „nicht genug investiert“ habe. Eine kritische Haltung wird selten geduldet. Die Folge: Viele geben innerhalb kurzer Zeit auf. Die Fluktuation ist hoch, der Traum vom selbstbestimmten Unternehmertum platzt häufig schon in der Probephase.
Angebliche Produktvielfalt – faktische Einbindung
Auch die oft betonte „Anbieterunabhängigkeit“ ist bei genauer Betrachtung fragwürdig. Zwar listet die DVAG zahlreiche Partnergesellschaften – von Generali über DWS bis zur Deutschen Bank. In der Praxis jedoch dominieren Produkte verbundener Unternehmen, allen voran der Generali-Gruppe, die selbst Großaktionär der DVAG ist.
Beratungen führen daher oft zu Policen, Bausparverträgen oder Fondsprodukten, die dem eigenen Netzwerk zuarbeiten – nicht unbedingt der objektiv besten Lösung für den Kunden.
Insiderberichte, etwa aus einer ZDF-Reportage oder von Stiftung Warentest, bestätigen: Empfohlen wird, was hohe Provisionen bringt – nicht unbedingt, was günstig oder leistungsstark ist. Das Vertrauen in den „Vermögensberater“ basiert auf einer Beratungssituation, in der der Interessenkonflikt oft nicht offengelegt wird.
Vertrieb im Spannungsfeld von Ideal und Interessen
Die DVAG stellt sich gern als moderne, transparente Karriereplattform dar – mit flexiblen Arbeitszeiten, großem Verdienstpotenzial und starken Werten. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein System, das auf Druck, Kontrolle und Loyalität setzt – und sich auf eine Struktur stützt, bei der viele unten scheitern, während wenige oben profitieren.
Für Kunden bedeutet das: Wer zur DVAG geht, sollte wissen, dass er nicht mit einem neutralen Finanzberater spricht, sondern mit einem Vertriebsmitarbeiter – in einem Netzwerk, das klare Vorgaben und klare Gewinner kennt.
Regulierung im Vertriebsgraubereich – wie die DVAG Spielräume nutzt
Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) ist kein Finanzinstitut im klassischen Sinne – sie ist kein Versicherer, keine Bank und keine lizenzierte Vermögensverwaltung. Das hat regulatorische Konsequenzen: Auf Unternehmensebene unterliegt sie nicht direkt der Aufsicht der BaFin, sondern agiert im rechtlich zulässigen Rahmen als Vertriebsgesellschaft.
Damit entfällt eine zentrale staatliche Kontrolle, wie sie für Banken oder Kapitalverwaltungsgesellschaften gilt. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften wird auf tausende einzelne Vermittler ausgelagert.
Gewerbeerlaubnis statt Bankenlizenz
Die rund 18.000 DVAG-Vermögensberater benötigen für ihre Tätigkeit lediglich eine gewerberechtliche Erlaubnis nach § 34d GewO (Versicherungen), § 34f GewO (Finanzanlagen) und ggf. § 34i GewO (Darlehen). Die Erteilung dieser Genehmigungen erfolgt durch die zuständigen Industrie- und Handelskammern (IHK), nicht durch Bundesbehörden. Damit liegt die Qualitätskontrolle bei den dezentralen Stellen – ein System, das Verbraucherschützer regelmäßig als unzureichend kritisieren.
Im öffentlichen Vermittlerregister sind tausende DVAG-Berater gelistet, oft als „Versicherungsvertreter mit Erlaubnis“. Dass viele davon faktisch fast ausschließlich Generali-Produkte vertreiben – ein Konzern, der 40 % der DVAG-Anteile hält – wirft Fragen nach der Unabhängigkeit der Beratung auf.
Haftungsdach statt Eigenverantwortung
Im Bereich der Fondsberatung operiert die DVAG über ein sogenanntes Haftungsdach. Das bedeutet: Ein extern oder konzernintern lizenziertes Institut übernimmt die rechtliche Verantwortung für Anlageberatungen. Für Berater hat das Vorteile – sie benötigen keine eigene BaFin-Zulassung.
Für Kunden hingegen ist dieses Modell wenig transparent. Zwar steht im Kleingedruckten, wer formell Vertragspartner ist, doch viele wissen gar nicht, dass sie mit einem Berater sprechen, der nicht selbst verantwortlich, sondern lediglich „angeschlossen“ ist.
Insiderberichten zufolge hält die DVAG ein eigenes haftendes Institut bereit, um regulatorische Hürden zu umgehen. Auch die enge Anbindung an Großbanken wie die Deutsche Bank kann dazu dienen, Beratungsleistungen formal über lizenzierte Dritte zu deklarieren – ein juristisch sauberer, aber konstruktiv komplexer Umweg, der wenig zur Klarheit beiträgt.
BaFin bleibt auf Abstand – noch
Seit Jahren diskutieren Fachpolitiker, ob auch §34f-Vermittler der BaFin-Aufsicht unterstellt werden sollen – bislang bleibt es bei Absichtserklärungen. Widerstand kommt vor allem von Strukturvertrieben wie der DVAG, die durch eine mögliche Verschärfung Massenabgaben von Zulassungen befürchten.
Brancheninterne Schätzungen gehen davon aus, dass viele Berater in einem solchen Fall unter das Haftungsdach der DVAG wechseln würden – mit der Folge, dass regulatorische Verantwortung zentralisiert, aber nicht notwendigerweise erhöht wird.
Selbstregulierung mit Fragezeichen
Die DVAG verweist regelmäßig auf ihre hohen Ausbildungsstandards und Mitgliedschaften in Branchenverbänden wie dem BVK. Sie hat auch den GDV-Verhaltenskodex für Versicherungsvermittler unterzeichnet – ein freiwilliges Regelwerk für fairen Vertrieb. Doch ob diese Standards im Alltag eingehalten werden, bleibt fraglich. Kritiker bemängeln, dass manche Vertriebspraktiken – etwa das gezielte Umschichten bestehender Verträge – an der Grenze zur Irreführung operieren.
Ein besonders brisanter Fall ereignete sich 2021: Der Maklerpool Maxpool warf der DVAG „unlauteren Wettbewerb“ vor, nachdem Kunden angeblich mit sogenannten „Mandantenschutzbriefen“ zum Bleiben bewegt wurden – mit zweifelhaften Aussagen über unabhängige Makler.
Die DVAG bestritt die Urheberschaft solcher Schreiben. Doch der Vorfall zeigt exemplarisch, wie unscharf die Grenzen zwischen legitimer Kundenbindung und Wettbewerbsverstoß verlaufen – und wie viel im Schatten der legalen Grauzonen passiert.
Verträge, Haftung, Verantwortung – wer steht wirklich hinter der Beratung?
Auch haftungsrechtlich bleibt die Struktur undurchsichtig. Verträge werden meist zwischen Kunde und Berater geschlossen – nicht mit der DVAG selbst. Bei Falschberatung haftet im Zweifel der Vermittler persönlich, obwohl dieser oft kaum Rücklagen hat. Zwar verlangt die DVAG eine Vermögensschaden-Haftpflicht, aber ob diese im Ernstfall ausreicht, bleibt offen. Die Verantwortung des Unternehmens bleibt im Hintergrund – ebenso wie seine tatsächliche Rolle bei der Empfehlung einzelner Produkte.
Regulierung formell erfüllt – Transparenz bleibt ausbaufähig
Die DVAG bewegt sich rechtlich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, nutzt aber alle Spielräume, die sich aus der Kombination aus Einzelzulassungen, Haftungsdachmodellen und fehlender Zentralaufsicht ergeben. Für Kund:innen bedeutet das: Die Beratung wirkt professionell – ist aber in der Verantwortung stark zergliedert. Die Frage, wer im Zweifel haftet, ist oft nicht eindeutig zu beantworten.
Und ob es dabei immer im besten Kundeninteresse zugeht, ist angesichts der vertrieblich geprägten Strukturen mindestens fraglich.
DVAG: Erfolg mit Nebenwirkungen – Reputationsrisiken eines Vertriebsriesen
Trotz Milliardenumsätzen und Auszeichnungen bleibt das Image der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) ambivalent. Während das Unternehmen sich als vertrauensvoller Allfinanzpartner inszeniert, sehen Kritiker in der DVAG einen klassischen Strukturvertrieb mit systemischen Schwächen. Zwischen Kundenorientierung und Provisionsdruck, Eigenlob und interner Kritik entsteht ein Bild, das zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerät – und das erhebliche Reputationsrisiken birgt.
Pyramidenvorwurf und Unternehmenskultur
Seit den 1980er Jahren steht das Vertriebssystem der DVAG im Kreuzfeuer. Immer wieder wird das mehrstufige Provisionsmodell als verkapptes Pyramidensystem kritisiert – zuletzt 2021 vom ZDF Magazin Royale, das von einer „sektenähnlichen Struktur“ sprach.
Die Kritik: Führungskräfte verdienen an den Abschlüssen ihrer Untergebenen mit – das schaffe internen Verkaufsdruck und führe dazu, dass nicht zwingend das beste Produkt für den Kunden, sondern das lukrativste für die Struktur verkauft werde.
Solche Vorwürfe sind nicht neu – und sie finden Echo bei ehemaligen Beratern. Ein Insider verglich die interne Kultur gegenüber der Welt mit einer „Gehirnwäsche“; andere berichten von missionarischem Eifer und systematischem Druck, vor allem im privaten Umfeld zu rekrutieren. Die DVAG weist diese Vergleiche vehement zurück – doch allein die Präsenz dieser Begriffe im öffentlichen Diskurs schadet der Außenwahrnehmung.
Mangelnde Transparenz bei Kosten und Beratung
Auch die Qualität der Beratung steht in der Kritik. Eine Finanztest-Studie von 2014 attestierte der DVAG zwar im Vergleich zu anderen Großvertrieben das „beste“ Ergebnis – allerdings im negativen Sinne: Kein Anbieter erhielt die Note „gut“. Besonders bemängelt wurde die Intransparenz der Kostenstruktur. Kunden wussten nach Gesprächen oft nicht, was sie die Produkte tatsächlich kosten würden.
Hinzu kommen Vorwürfe systematischer Verkaufspraktiken, etwa aggressives Cross-Selling. Kritiker berichten, dass DVAG-Berater gezielt mehrere Verträge aus verschiedenen Sparten verkaufen – oft unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Nach der Wiedervereinigung etwa seien ostdeutschen Haushalten massenhaft teure Lebens- und Unfallversicherungen angeboten worden – ein Vorgehen, das aus heutiger Sicht als verkaufsgetriebene Überversorgung gilt.
Bewertungen zwischen Imagepflege und Manipulationsvorwurf
Die Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und öffentlichem Feedback zeigt sich auch auf Bewertungsplattformen. Während die DVAG auf ihrer Website mit über 115.000 positiven Kundenbewertungen (4,9 von 5 Sternen) wirbt, fällt das Bild auf unabhängigen Portalen gemischt aus. Auf Trustpilot etwa häuften sich bis 2020 kritische Einträge – bis ein sprunghafter Anstieg positiver Bewertungen auffiel.
Recherchen zeigten: Ein DVAG-Direktionsleiter hatte Berater intern zur Abgabe von Fünf-Sterne-Rezensionen aufgefordert. Trustpilot kennzeichnete viele dieser Bewertungen später als „missbräuchlich“.
Auch auf Kununu, einer Arbeitgeber-Plattform, polarisiert die DVAG: Überdurchschnittliche Gesamtnoten stehen im Kontrast zu eindeutigen Erfahrungsberichten ehemaliger Vermittler, die von Ausbeutung, Erfolgsdruck und geringer Wertschätzung berichten.
Aussteigerberichte und juristische Auseinandersetzungen
Besonders brisant sind die Stimmen ehemaliger Mitarbeiter. So beschreibt ein Ex-Berater namens „Tim“ in einem Onlineportal, wie er nach seinem Ausstieg mit Stornohaftungen konfrontiert wurde und sich von der DVAG „im Stich gelassen“ fühlte. In einem Fall forderte die DVAG von einem Aussteiger fast 7.000 Euro Provisionsrückzahlung – das zuständige Amtsgericht wies die Klage ab, weil Zweifel an der Abrechnung bestanden.
Derartige Fälle landen regelmäßig in Fachmedien – mit Imageverlust für das Unternehmen.
Ein anderer Vorwurf betrifft Scheinselbstständigkeit: DVAG-Vermittler seien formal frei, würden aber in der Praxis so stark gesteuert, dass sie faktisch abhängig beschäftigt seien – ein Vorwurf, der auch sozialversicherungsrechtlich relevant ist und seit Jahren diskutiert wird.
Rufschäden durch externe Konflikte
Auch über externe Konflikte geriet die DVAG ins Zwielicht. Die Rufmordaffäre um Stefan Schabirosky, einen früheren Mitarbeiter des Konkurrenten AWD, beschädigte das Image – obwohl die DVAG jede Beteiligung bestritt. Ebenso unvorteilhaft: Enthüllungen über bezahlte PR-Texte im Graumarktumfeld (GoMoPa, 2012), mutmaßlich gesteuerte Online-Kampagnen und juristische Auseinandersetzungen mit Maklerpools wie Maxpool, die der DVAG irreführende Aussagen über Wettbewerber vorwarfen.
Zwischen Glanzfassade und Graubereichen
Die DVAG kontert Kritik mit Imagekampagnen, Auszeichnungen und prominenten Testimonials wie Michael Schumacher oder Jürgen Klopp. Sie verweist auf Auszeichnungen wie „Top Employer“ oder „Deutschlands Kundenchampions“. Doch der Kontrast zur intern berichteten Realität bleibt frappierend. Dass das Unternehmen regelmäßig gegen Kritiker – etwa Buchautoren wie Wolfgang Dahm – den Rechtsweg beschreitet, unterstreicht: Die Markenpflege ist zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.
Image in der Balance
Die DVAG steht vor einer Reputationsherausforderung. Einerseits wirtschaftlich erfolgreich, gut vernetzt, professionell organisiert. Andererseits haftet ihr das Stigma eines provisionsgetriebenen Strukturvertriebs mit teils fragwürdigen Methoden an. Viele Vorwürfe bewegen sich in rechtlichen Grauzonen, juristische Verurteilungen blieben bislang aus. Doch in Zeiten digitaler Sichtbarkeit kann jeder kritische Bericht zum Flächenbrand werden.
Der künftige Ruf der DVAG wird davon abhängen, ob sie es schafft, von der Vertriebsorientierung zur echten Kundenorientierung umzuschwenken – und ob sie mehr Transparenz wagt, wo bisher Hochglanzbroschüren und Testimonials dominieren.
DVAG im Fokus: Offene Fragen, unbequeme Wahrheiten?
Die Deutsche Vermögensberatung AG präsentiert sich als moderner Finanzdienstleister mit klarer Mission: Menschen zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Doch je tiefer man in die Strukturen blickt, desto mehr stellen sich Fragen, die über die Marketingversprechen hinausgehen. Nicht um zu verurteilen – sondern um Transparenz einzufordern, wo sie bislang fehlt.
Sieben begründete Fragen, die auf Antworten warten:
1. Wer profitiert wirklich vom System DVAG?
Sind es die Kunden – oder vor allem die Strukturspitzen und Eigentümer? Ein erheblicher Anteil jeder Provision versickert in der mehrstufigen Hierarchie. Ist das effizient – oder schlicht teuer für den Kunden? Und wie viel Beratungsqualität bleibt am Ende übrig, wenn das System vor allem oben verdient?
2. Warum werden bestimmte Produkte bevorzugt verkauft?
Ist es wirklich der individuelle Bedarf, der entscheidet – oder die Margen der Anbieter? Wenn fast jeder Kunde eine fondsgebundene Rentenversicherung angeboten bekommt, stellt sich die Frage: Ist das noch Beratung – oder Vertrieb mit Zielvorgabe? Gibt es interne Rankings oder „Produktkampagnen“, die Empfehlungen subtil steuern?
3. Wie unabhängig sind DVAG-Berater tatsächlich?
Die DVAG wirbt mit „unabhängiger Allfinanzberatung“. Gleichzeitig ist sie eng mit der Generali verbunden – ein Konzern, der Anteile hält und Produkte liefert. Kann ein Berater objektiv handeln, wenn er Teil eines Systems ist, das wirtschaftlich an bestimmte Anbieter gebunden ist?
4. Werden die Risiken des Strukturvertriebs transparent kommuniziert?
Gegenüber neuen Vermittlern wird mit Selbstverwirklichung geworben – aber wie offen wird über hohe Fluktuation, Stornohaftung und Anfangsverluste gesprochen? Und wie klar ist Kunden, dass ihr Berater auf Provision arbeitet, wirtschaftlich unter Druck steht und möglicherweise eigene Umsatzziele verfolgt?
5. Warum bleibt das Vergütungssystem so intransparent?
Weder Berater noch Kunden sehen auf den ersten Blick, wer wie viel verdient – und welche Anreize hinter einer Produktempfehlung stehen. Sollte ein Unternehmen, das Vertrauen verkaufen will, nicht auch sein Vergütungsmodell offenlegen – wie es in anderen Ländern längst üblich ist?
6. Ist „kostenlose Beratung“ ein irreführendes Versprechen?
Kunden zahlen kein Honorar – aber indirekt sehr wohl: über Abschlusskosten, Gebühren, reduzierte Renditen. Ist es redlich, solche Beratung „kostenlos“ zu nennen, wenn sie mitunter teurer ist als ein Onlineabschluss oder eine unabhängige Honorarberatung?
7. Wie geht die DVAG mit Kritik um – und was verrät das über ihre Kultur?
Vergangene Fälle zeigen eine harte Gangart gegen Kritiker: Klagen gegen Autoren, juristische Auseinandersetzungen mit Aussteigern, PR-Maßnahmen zur Imagepflege. Steht dahinter ein legitimes Interesse an Markenwahrung – oder eine Tendenz zur Verdrängung unangenehmer Wahrheiten?
Fazit: Fragen statt Vorwürfe – aber Antworten sind nötig
Diese Fragen sind keine Unterstellungen, sondern legitime Prüfsteine für ein Unternehmen, das mit Vertrauen wirbt. Die DVAG hätte die Möglichkeit, öffentlich, transparent und nachvollziehbar Stellung zu nehmen – nicht in Hochglanzbroschüren, sondern mit belastbaren Zahlen, unabhängigen Studien und klaren Erklärungen.
Bis dahin bleibt: gesunde Skepsis. Wer sich beraten lässt oder als Vermittler einsteigen will, sollte genau hinsehen – und nicht nur auf das hören, was in Seminaren oder Imagekampagnen vermittelt wird. Denn in der Finanzbranche gilt mehr als anderswo: Vertrauen ist gut – verstehen ist besser.
Scoredex-Seriositätsüberprüfung
Sollten Sie an einem Check oder Demonstration Ihrer Seriosität interessiert sein (Scoredex-Seriositätsüberprüfung), beachten Sie bitte:
Die kostenpflichtige Prüfung umfasst über 100 strukturierte Fragen. Je nach Einzelfall sind Nachweise oder Dokumente einzureichen, die Ihre Angaben stützen.
Der ermittelte Scoredex-Seriositätsfaktor wird fortlaufend überprüft und bei neuen Erkenntnissen automatisch aktualisiert. Unsere Kunden werden über relevante Entwicklungen informiert.
Bei mindestens befriedigendem Ergebnis wird ein Scoredex-Qualitätssiegel vergeben, das insbesondere im Vertrieb Vertrauen schafft – und das bei Scoredex nur unter strengen Voraussetzungen zu erreichen ist.
Hinweise:
Der Beitrag ist ein KI-unterstützter Scoredex-Faktencheck. Er basiert auf einer unabhängigen, journalistisch ausgearbeiteten und rechtlich überprüften Internetrecherche unter Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen. Unterstützt durch algorithmische Analyseverfahren werden Fakten strukturiert aufbereitet – ohne subjektive Meinung oder abschließende Bewertung. Ziel ist eine sachliche Einordnung auf Basis dokumentierter Informationen.
Falls Sie mit bestimmten Aspekten unseres Faktenchecks nicht einverstanden sind oder berechtigte Korrekturwünsche haben, laden wir Sie ein, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir werden Ihr Anliegen umgehend und ohne Kosten prüfen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen.
Dieser Faktencheck basiert auf einer KI unterstützten journalistischen Internetrecherche und stellt keine offizielle Scoredex-Seriositätsbewertung dar. Ein Scoredex-Seriositätsbewertung ist ein neutraler, Algorithmus gestützter Analyseprozess, der sowohl auf- als auch abwerten kann.
Quellen
Offizielle Unternehmensangaben: DVAG-Website (Produktübersicht, Partnerunternehmen, Karriereinformationen)dvag.de; DVAG-Unternehmensbericht/Facts & Figures. Handelsregister Frankfurt (HRB 2423) für Eigentümerstruktur. Lobbyregister-Bundestag (Parteispenden DVAG) de.wikipedia.org.
Register & Regulierung: DIHK-Vermittlerregister (Einträge der DVAG-Vermögensberater nach §34d/f GewO). Branchenverband BVK-Stellungnahmen (zur BaFin-Aufsicht über Vermittler) versicherungswirtschaft-heute.de. BaFin/Versicherungsaufsicht: Beschwerdestatistiken (indirekt relevant für Generali-Produkte).
Presse- und Medienberichte: Stiftung Warentest (Finanztest) 5/2014 – Vergleich von FinanzvertriebenWirtschaftsWoche (Grafik politisches Netzwerk DVAG, 2010). Der Spiegel, 15.4.2019 – Bericht über Ex-Mitarbeiter und Vertriebsdruck. Die Welt, 2017 – Interview mit Aussteiger („Gehirnwäsche“-Zitat). ZDFzoom, 2012 (Reportage von Dominic Egizzi). ZDF Magazin Royale, Nov. 2021 (satirische Aufbereitung DVAG-System). ARD Frontal – Beitrag „DVAG: Abzocke oder Versicherung?“ (YouTube, 24.11.2021) de.wikipedia.org.
Fachpresse und Blogs: Versicherungsbote, 2020 – Artikel „DVAG unterliegt in erster Instanz Provisionsrückzahlung“(AG Bad Schwalbach Urteil) versicherungsbote.de. Versicherungswirtschaft-heute, 12.3.2021 – „DVAG stoppt Kampagne mit Fake-Bewertungen auf Trustpilot“ versicherungswirtschaft-heute.de. DAS INVESTMENT, 12.3.2021 – „DVAG kündigt Reaktion auf gefälschte Bewertungen an“ dasinvestment.com. Pfefferminzia, 26.5.2021 – „Maxpool mahnt DVAG wegen irreführender Handlung ab“ (Mandantenschutzbriefe) pfefferminzia.de. FondsProfessionell, 2020 – Bericht über Änderungen im Karrieresystem DVAG (Stichwort: „torpediert eigenes System“). Finanzwende Recherche (Bürgerbewegung Finanzwende), 2023 – Blogartikel „Drei gute Gründe, der DVAG den Rücken zu kehren“ (nennt Lobby, Produkte, Struktur).
Erfahrungsberichte & Bücher: Wolfgang Dahm: „Beraten und Verkauft“ (1997, Langen Müller Verlag) – Insiderbericht eines Ex-DVAGlers. Stefan Schabirosky: „Mein Auftrag: Rufmord“ (2017) – allerdings aus AWD-Sicht, mit DVAG-Bezugde.wikipedia.org. Online-Foren: GoMoPa-Forum (diverse Beiträge zu DVAG, z.B. 2014 „Klage gegen DVAG wegen Falschberatung“), diebewertung.de (Blog mit Warnungen, z.B. zu Strukturvertrieben einschließlich DVAG), Reddit (r/Finanzen und r/StrukkiLeaks – Threads mit Erfahrungen über DVAG reddit.com). Diese Foren sind anonym, Inhalte mit Vorsicht zu genießen, geben aber Stimmungsbilder.
Bewertungsportale: Trustpilot – Profil „Deutsche Vermögensberatung“ (Achtung: DVAG versuchte beeinflusste Bewertungen, viele 5-Sterne könnten von eigenen Mitarbeitern stammen) versicherungswirtschaft-heute.de. Kununu – Arbeitgeberprofil DVAG (1350+ Bewertungen, polarisierende Kommentare) kununu.comkununu.com. WhoFinance / Google Reviews – Kundenbewertungen lokaler Berater (sehr unterschiedlich je nachdem, oft entweder sehr positiv oder sehr negativ).
Investigative Artikel/Reportagen: MOMENT.at, 17.3.2022 – „Ex-Mitarbeiter: Hat sich angefühlt wie eine Sekte“ (Interview/Video mit „Tim“) moment.atmoment.at. Süddeutsche Zeitung, 2021 – Artikel „Grobes Foul von der DVAG“ (Thema Kick-back bei Fondspolicen) – hier ging es um versteckte Provisionen in fondsgebundenen Versicherungen, die DVAG seit 2020 vereinnahmt de.wikipedia.org. RTL / stern TV – gelegentlich Zuschauerberichte über DVAG (z.B. Fälle von Überschuldung durch Strukturvertrieb).
Offizielle Dokumente: Bundesanzeiger – Jahresabschlüsse DVAG Holding (zeigen Gewinnentwicklung). DIHK-Sachkundenachweis-Statistiken (DVAG erwähnt als großer Anbieter von Prüfungsabsolventen). Prospekte der Generali für DVAG-Exklusivprodukte (z.B. „Generali VISION“ Fondsrente, welche DVAG verkauft – enthalten Kostenquoten).
(Hinweis: Alle zitierten Stellen im Text sind mit Quellenangaben im Format (Quellen-Nr+Zeile) versehen, um Überprüfbarkeit zu gewährleisten. Die genannten Quellen decken sowohl die Eigenkommunikation der DVAG als auch unabhängige Tests, Medienberichte und Stimmen von Beteiligten ab.)


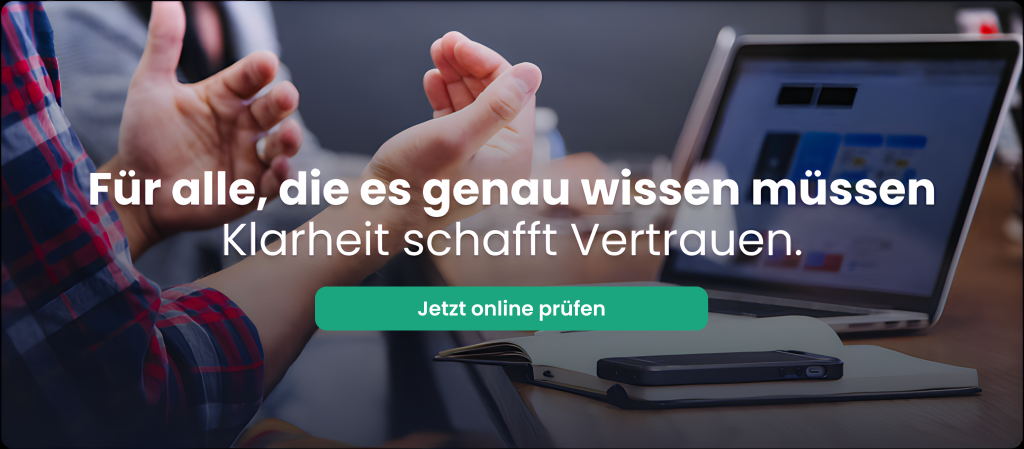





Noch kein Kommentar vorhanden.